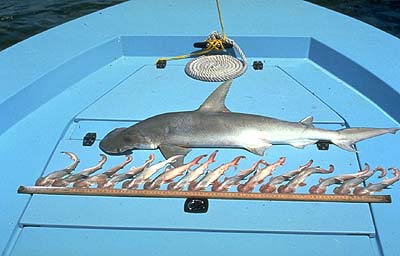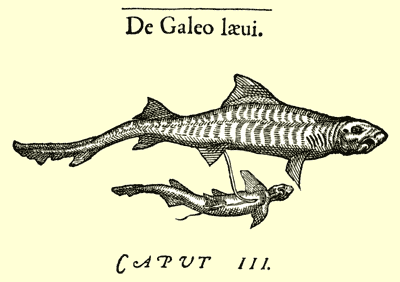|
|
|
|
|
|
Shark Info (15.03.2000) |
Author |
|
Intro: |
Shark Info |
|
Hauptartikel: |
Andrew C. Cobb |
|
Artikel 1: |
Prof. H. Greven |
|
Artikel 2: |
Prof. M. S. Shivji |
|
Fact Sheet: |
Dr. E. K. Ritter |
|
Lebendgebären bei HaienVon Prof. H. Greven Haie sind in aller Munde: Nicht nur als Haiflossensuppe und Potenzmittel sondern auch wegen ihrer meist räuberischen Lebensweise und ihrer vermeintlichen Blutrünstigkeit. Dabei wird vergessen, dass fast 70% aller zur Zeit lebenden (rezenten) Haie sich besonders intensiv um ihren Nachwuchs kümmern und eine Form von Brutpflege betreiben, die wir eher mit Säugetieren in Verbindung bringen: Die Weibchen bewahren nämlich ihre sich entwickelnden Eier im Endabschnitt des Eileiters, der als Gebärmutter oder Uterus bezeichnet wird, auf und gebären nach einer längeren Tragzeit weit entwickelte, ausserordentlich selbständige Junge, sie sind also lebendgebärend. Der lange Aufenthalt im Muttertier schützt die Jungen wirksam vor Feinden. Im folgenden beschränke ich mich weitgehend auf die Darstellung der Verhältnisse bei Haien, obgleich manches davon auch für deren nahe Verwandte, die Rochen, gilt. Es gibt eierlegende und lebendgebärende Haie
Das Fortpflanzungssystem der Haie ähnelt dem der anderen Wirbeltiere - was auch zu erwarten ist -, nicht aber dem der meisten Knochenfische. Für alle weiblichen Haie gilt zunächst folgendes: Ihre Eier gelangen, wie beim Menschen, aus dem Eierstock in die Eileiter. Jeder Eileiter ist deutlich gegliedert. Zuerst kommt ein Trichter, der die Eier auffängt. Dann folgt ein Abschnitt, der die Schalendrüse beherbergt; sie ist besonders gut bei eierlegenden Arten entwickelt und dient dem Aufbau der kompakten, schützenden Eikapsel. Der Bereich hinter der Schalendrüse geht in den Endabschnitt, die Gebärmutter, über. Der Eileiter nimmt auch das Sperma der Männchen auf. Die Eier müssen natürlich weit oben im Eileiter, noch vor der Schalendrüse, besamt werden, da die Spermien sonst die Eischale, die von der Schalendrüse gebildet wird, nicht mehr durchdringen können. Die Männchen haben für die bei Haien übliche innere Besamung ihre Beckenflossen zu einem paarigen Begattungsorgan umgebildet. Haie, ob eierlegend oder lebendgebärend, produzieren mit ganz wenigen Ausnahmen relativ wenige, aber grosse, dotterreiche Eier. Arten, die diese mit einer ausserordentlich widerstandsfähigen Hülle versehen und frei ablegen, sind eierlegend. Die lebendgebärenden Arten umgeben ihre Eier nur mit einer sehr dünnen Hülle. Herkunft und Art der Nahrung sind von BedeutungDie Entwicklungsvorgänge der Embryonen benötigen Energie. Die Wissenschaftler unterscheiden drei Möglichkeiten, wie der Embryo zu dieser Energie kommt: Eierlegende Haie:
Lebendgebärende Haie:
Es versteht sich von selbst, dass die von der Mutter zusätzlich gelieferte Nahrung zu den Jungen gelangt und von diesen auch aufgenommen werden muss. Dies geschieht bei Haien, wie wir weiter unten sehen, auf unterschiedliche und zum Teil ganz ungewöhnliche Art und Weise. Johannes Müller, Steno, Rondelet und AristotelesErste grundlegende Untersuchungen zum Lebendgebären von Haien und zur Ernährung der Jungen in der Gebärmutter stammen von Johannes Müller (1801-1858), einem deutschen Physiologen, der vielen als der Begründer einer wissenschaftlichen Zoologie gilt. Als erster hat jedoch der griechische Philosoph Aristoteles (384 -322 v. Ch.) die Ernährung von Embryos durch ihre Mutter beim Glatthai Mustelus canis beschrieben. Aristoteles hat die sogenannte Dottersackplacenta entdeckt und unterschied bereits zwischen eierlegenden Haien mit ihren Eikapseln und lebendgebärenden Arten. Offenbar hat der französische Naturwissenschaftler und Mediziner G. Rondelet (1507-1556) in seinen 1554 erschienenen Büchern über die Meeresfische («Libri de piscibus marinis...») einen weiblichen Hai nach der Beschreibung des Aristoteles abgebildet, der mit seinem Embryo durch eine Nabelschnur verbunden ist.
Die Placenta der Haie wurde erst 1673 von dem dänischen Anatom N. Steno (1638-1686) wiederentdeckt und abgebildet. Müller waren diese alten Arbeiten bekannt und er zitiert sie auch,wie es sich gehört. Er war sich aber mehr als seine Vorgänger der besonderen Bedeutung dieser und seiner eigenen Befunde bewusst und präsentierte sie der Öffentlichkeit so, dass seine Studien den Beginn einer intensiveren Erforschung der Fortpflanzung und Entwicklung von Haien und Rochen markieren. Ernährungsvarianten in der GebärmutterDie DottersackplacentaDie von Aristoteles entdeckte, spezialisierte Dottersackplacenta besitzen nur etwa 27% der lebendgebärenden Haiarten. Während der Entwicklung des Embryos dieser Arten wird zunächst der Dotter verbraucht. Anschliessend werden die sehr dünne Eihülle und der Dottersack (Anteil des Embryos an der Dottersackplacenta) durch komplizierte Falten so eng mit der Gebärmutter (mütterlicher Anteil der Dottersackplacenta) verzahnt, dass beide nicht mehr so ohne weiteres voneinander zu trennen sind. Die komplizierte Verzahnung resultiert in einer sehr grossen Kontaktoberfläche, über die Nährstoffe (Aminosäuren, Zucker, Fette) aus der Mutter in den Embryo gelangen. Abfallprodukte des Embryos (z.B. Harnstoff) gelangen in umgekehrter Richtung in den Kreislauf der Mutter und werden von ihr ausgeschieden. Die Dottersackplacenta ist über einen Dotterstiel, der zur Nabelschnur wird und Blutgefässe enthält, mit dem Embryo verbunden, wie auch auf der Zeichnung von Rondelet zu sehen ist. Die Haie, deren Embryos sich nur vom Dotter ernähren, haben natürlich keine Dottersackplacenta. Die Embryonen des Dornhais Squalus acanthias büssen so während der Entwicklung in der Gebärmutter bis zu 55% ihrer organischer Substanz ein, etwa so viel, wie Embryos von eierlegenden Haien. Das ist auch verständlich, da ja nur die Energie aus dem Dotter, die nicht nur in das Wachstum des Embryos fliesst, verbraucht werden und keine neue hinzukommt. Während der Trächtigkeit hat bei dieser Art der Ernährung des Embryos die Gebärmutter lediglich für den Austausch von Atemgasen sowie für den Transport von Wasser und Salzen zu sorgen. UterusmilchBei manchen Haiarten kann die Gebärmutter oder Uterus eine Flüssigkeit absondern, meist über besondere Ausstülpungen, die den bezeichnenden Namen «Uterusmilch» trägt. Da sie je nach Art mehr oder weniger Nährstoffe enthält, führt sie zum Beispiel beim Dornhai Squalus acanthias nur zu 1%, beim antarktischen Glatthai Mustelus antarcticus immerhin zu 110% Gewichtszunahme der Embryos. Bei manchen Haien können wahrscheinlich auch zusätzlich zur Dottersackplacenta Nährstoffe aus der Gebärmutter über die vergrösserte Oberfläche der Nabelschnur aufgenommen werden (z.B. Scharfnasenhai, Rhizoprionodon terraenovae). Kannibalismus in der GebärmutterBesonders dramatisch ist die Verpflegung der Embryos bei manchen Makrelenhaien (Lamniformes), z.B. beim Heringshai, Lamna nasus, und vor allem beim Sandtigerhai Carcharias taurus. Bei ersterem ist das Fressen von Eiern nachgewiesen worden, bei letzterem zusätzlich noch das Fressen anderer Embryonen. Beim Heringshai bleiben letztendlich nur zwei Junge pro Gebärmutter übrig, die unbefruchtete Eier fressen. Ihre gefüllten Mägen sind früher für einen Dottersack gehalten worden. Beim Sandtigerhai sind die Verhältnisse etwas besser bekannt. Anfangs findet sich in jedem Eileiter nur jeweils ein Ei. Weitere folgen und viele davon werden befruchtet und entwickeln sich auch. Ein kleiner Prozentsatz der sich entwickelnden Embryonen bildet vorzeitig Zähne und Sinnesorgane (Seitenlinienorgan) und verschlingt die unbefruchteten Eier und anderen Embryonen, bis nur noch ein Embryo pro Gebärmutter, der stärkste, übrigbleibt. Die Eier und Geschwister fressenden Jungtiere sind in der Gebärmutter ausserordentlich aktiv und schnappen nach allem, was ihnen in die Quere kommt, selbst nach der Hand des Untersuchers. Man kann hier mit Fug und Recht von Kannibalismus in der Gebärmutter sprechen. Zahlt sich die Brutpflege im Uterus aus?Betrachtet man Grösse und Gewicht der Neugeborenen scheint das Fressen von Eiern oder Geschwistern effektiver zu sein als die hochspezialisierte Dottersackplacenta. Bei Jungen, die über eine Dottersackplacenta ernährt werden, steigt das Gewicht während der Entwicklung «nur» um maximal etwa 1 000% (Blauhai, Prionace glauca 840%, Glatthai, Mustelus canis 1 050%), bei Jungen, die Eier und Geschwister fressen (Sandtigerhai, Carcharias taurus) aber bis 1 200 000%. Letztendlich kommt es bei lebendgebärenden Haien nach einer erstaunlich langen Tragzeit - sie schwankt je nach Art zwischen 6 und 22 Monaten - zur Geburt der Jungen. Die Grösse der Neugeborenen hängt vom Dottervorrat, zusätzlicher Ernährung durch die Mutter und natürlich auch vom Platz innerhalb der Gebärmutter ab und bewegt sich - sieht man einmal von den Extremwerten ab -, meist zwischen 45 und 60 cm. Frischgeborene Sandtigerhaie erreichen allerdings ca. 1 m und wiegen bis 9 kg, Weisse Haie bringen als Extremfall Junge von ca. 1.3 m Länge zur Welt. Das sind Längen, die sehr viele erwachsene Knochenfische nicht erreichen. Man kann daraus folgern, dass daher für den Junghai unter anderem die Anzahl möglicher Räuber und Konkurrenten verringert und das Spektrum an Futtertieren erweitert wird. Die Vorteile, die Junghaie haben, die ihre eigenen Geschwister oder Eier gefressen haben, liegen ebenfalls auf der Hand: Es werden grosse, zum Teil über einen Meter lange, gewissermassen «erfahrene» Räuber geboren. Bei all diesen Vorteilen scheint es für Haie kaum nötig zu sein, besonders zahlreiche Nachkommen in die Welt zu setzen. Tatsächlich schwankt die Anzahl der Neugeborenen auch nur zwischen 2 und 40; gelegentliche Berichte über mehr als 100 Junge (beim Sechskiemenhaie, Hexanchus) sind selten. Die Neigung mancher Jungtiere von Haiarten, die in flachen Küstengewässern leben, sich in gebührender Entfernung von den Erwachsenen in seichteren, beutereichen «Kinderstuben» aufzuhalten, bietet überdies einen gewissen Schutz vor ihren Hauptfeinden, grösseren Artgenossen und anderen Haien. Also scheint das Lebendgebären für Haie alles in allem erfolgreich zu sein. Spontan möchte man dies bejahen, zumal Haie schon so lange überlebt haben. Welches die treibenden Kräfte waren, die bei Haien die Evolution von Lebendgebären begünstigt haben, ist weitgehend unklar. Eine wesentliche Voraussetzung für diese Fortpflanzungsform ist die innere Besamung. Auffällig ist auch, dass die am Meeresboden und in den Küstenregionen lebenden eierlegenden Arten alle nicht sehr gross sind und dass, im Gegensatz dazu, lebendgebärende Arten ein grösseres Spektrum von Lebensräumen besiedeln. Bei Arten die im offenen Meer leben, mag Lebendgebären von Vorteil sein, weil die Tiere keine bestimmten Orte aufsuchen müssen, die für eine Eiablage geeignet wären. Es ist aber wahrscheinlich, dass sich auch die Jungen solcher Arten in Kinderstuben zusammenfinden. Nachdem der Mensch auf der Bildfläche erschienen ist, scheint aber die geringe Fortpflanzungsrate in Verbindung mit einem relativ langsamen Wachstum und der spät einsetzenden Geschlechtsreife - viele Arten werden erst mit 10 bis 12 Jahren fortpflanzungsfähig - für Haie eher von Nachteil zu sein, da Verluste, wie bei einer Überfischung, nicht schnell genug wieder ausgeglichen werden können.
Weiterführende Literatur
* Prof. H. Greven ist seit 1986 Professor für Zoologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seine Arbeitsgruppe befasst sich vornehmlich mit vergleichenden Aspekten des Lebendgebärens bei verschiedenen Wirbellosen und Wirbeltieren (keine Säugetiere). Veröffentlichung nur mit Quellenangabe: Shark Info / Prof. H. Greven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||